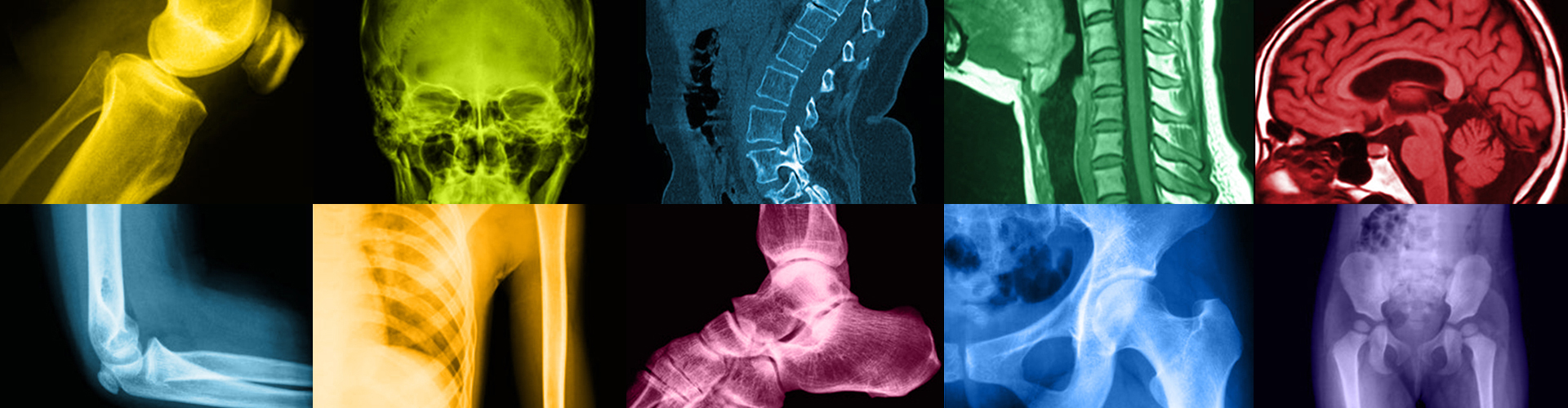Entspannende Wirkung bildgebender Diagnostik beim Rückenschmerz
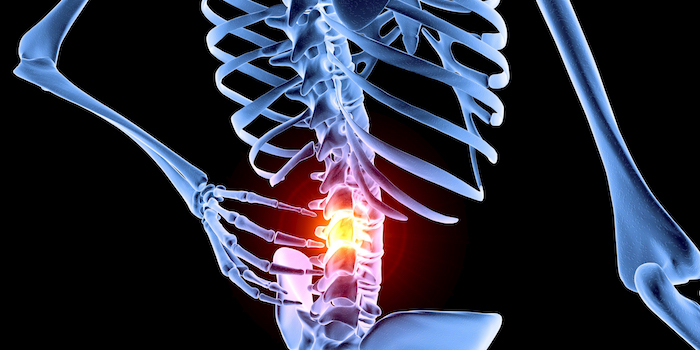
PatientInnen sind entspannter, wenn sie wissen, dass eine in der Bildgebung sichtbare Wirbelsäulen-Degeneration verbreitet auftritt und nicht Ursache für den Schmerz ist. Das wirkt sich auch positiv auf das Schmerzempfinden aus.
-
Datum:29.09.2020
-
Autor:B. Albers (mh/ktg)
-
Quelle:Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V.
Die bildgebende Routinediagnostik der Wirbelsäule zeigt bei PatientInnen mit Rückenschmerzen relativ häufig auffällige Befunde, die meist nicht mit den Beschwerden korrelieren. Solche meist alterstypischen Abnutzungen findet man auch bei beschwerdefreien Menschen. Wie wichtig diese relativierende Information für ÄrztInnen und PatientInnen ist, zeigt nun eine Studie aus den USA: Die informierten PatientInnen benötigten weniger Opioide.
Randomisierte Studie mit über 250.000 TeilnehmerInnen
Die randomisierte Studie untersuchte anhand der von HausärztInnen veranlassten spinalen Bildgebung, welche Auswirkungen es auf die Versorgung der PatientInnen hat, wenn man solche Informationen zur Prävalenz typischer radiologischer Zufallsbefunde in den Befundbericht mit einbezieht.
Die Studie screente über 250.000 erwachsene TeilnehmerInnen mit Rückenschmerzen aus 98 Einrichtungen der medizinischen Primärversorgung. Die TeilnehmerInnen wurden in zwei Gruppen randomisiert: In der Kontrollgruppe wurden „herkömmliche“ radiologische Befundberichte erstellt, in der Interventionsgruppe beinhalteten die Befundberichte zusätzlich Hinweise zur Prävalenz solcher Abnutzungserscheinungen und altersbedingten Wirbelsäulenanomalien bei gleichaltrigen Menschen ohne Rückenbeschwerden.
Untersucht wurde, ob sich die Arztbesuche und die Therapie zwischen den beiden Gruppen unterschied, also ob das Wissen darüber, dass die „Anomalie“ gewissermaßen normal ist, die Krankheitswahrnehmung der Betroffenen beeinflusste.
Weniger Opiode rezeptiert
Im Ergebnis war in der Interventionsgruppe zwar insgesamt kein Rückgang der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung zu verzeichnen. Ein Unterschied zeigte sich allerdings im sekundären Endpunkt: Bei Patienten der Interventionsgruppe waren weniger opiathaltige Schmerzmittel rezeptiert worden als in der Kontrollgruppe. Der Unterschied war zwar insgesamt nicht groß, aber doch statistisch signifikant (36,2% vs. 37%; OR 0,95; p=0,04). Betrachtete man nur die PatientInnen, die vor der bildgebenden Untersuchung keine Opioide benötigt hatten, war der Gruppenunterschied deutlich größer: Im Zeitraum von 12 Monaten wurden 25% der PatientInnen, denen die Bildgebung erklärt und die Befunde relativiert worden waren, Opioide verschrieben, in der Kontrollgruppe erhielten 75% Opioide – also dreimal so viele.
„Schmerztherapeutisch ist das gut nachvollziehbar“, erklärt Professor Hans-Christoph Diener, Essen, Pressesprecher der DGN. „Patienten, die wissen, dass eine bestimmte in der Bildgebung sichtbare Abnutzungserscheinung allgemein häufig ist und nicht in einem kausalen Zusammenhang mit dem Schmerz stehen oder gar gefährlich sind, sind entspannter, was sich dann wiederum positiv auf das Schmerzempfinden und die Psyche auswirkt. Daher ist die Patientenedukation bereits eine wesentliche Säule der multimodalen Therapie bei Patienten mit chronischen Schmerzen. Denn Wissen hilft gegen Schmerzen.“
Zur Studie in JAMA Network Open 2020